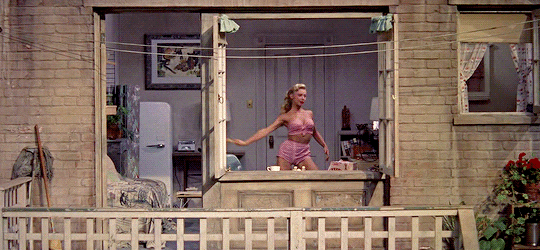
Es war noch nicht einmal 8 Uhr, aber die Sonne knallte jetzt schon. Die Plattenfassade des Hauses lag in einem Kegel aus heißem, gelbem Licht, wie eine Bühne. Ein Fenster im dritten Stock stand sperrangelweit offen, und von der Straße aus, die ich gerade hinunter lief, konnte ich im Fensterrahmen den Oberkörper einer Frau erkennen. Dass sie nackt war, verstand ich nicht gleich – ihre Brüste hingen ziemlich weit herunter, die Nippel zu schlaff, um noch über den Sims spähen zu können. Sie trug ein türkisfarbenes Handtuch um den Kopf gewickelt, das im Sonnenstrahl grell leuchtete. Allem Anschein nach hatte sie sich absichtlich so nah ans Fenster gestellt. Vielleicht wartete sie auf einen heimlichen Angebeteten, der hier hoffentlich gleich vorbeikäme. Jetzt bückte sie sich, hob etwas auf und legte dann mit dem routinierten Handgriff, den alle Frauen kennen, einen hellblauen Spitzen-BH an: vorne zuknipsen, Verschluss nach hinten drehen, Träger über die Schultern streifen. Ich sah noch, wie sie ihre Brüste prüfend in ihren Händen wiegte, vielleicht, um sich daran zu erfreuen, dass sie noch da waren, zwar nicht mehr ganz rund, aber doch eines hellblauen Spitzen-BHs würdig. Dann trat sie vom Fenster weg.
Ich musste an die Eröffnungsszene des Films „Rear Window“ von Alfred Hitchcock denken, wie die Kamera über die Feuerleitern und Fenster eines Hinterhofes streift, man sieht einen blonden Hinterkopf, der gebürstet wird, einen Mann, der auf dem Balkon erwacht, einen anderen, der sich rasiert, dann wieder das Balkonbett, auf dem sich jetzt auch eine zweite Person regt, dann wieder den mittlerweile hochgesteckten blonden Schopf und dazugehörigen Frauenkörper, der versucht, einen rosa BH anzuziehen und sich dabei eine Spur zu kokett bewegt, wahrscheinlich ahnend, dass bewundernde Beobachter anwesend sind.
An diesem Morgen war ich für ein paar Sekunden die Kamera, Zaungast der Privatsphäre der Frau mit dem blauen Handtuch. Und obwohl wir uns nicht kannten und ich auf der Straße stand und sie oben im dritten Stock und mich wahrscheinlich noch nicht einmal bemerkte, hatte der Moment eine Schärfe und Klarheit, die mich berührte. Es war ein Bild vom Sommer, von Freiheit, von der Schönheit alltäglicher Rituale. Etwas später, als ich an der Ampel stand, dachte ich, dass das eine Szene war, die man hätte malen – oder heute wohl eher: fotografieren – wollen. Auf Instagram wäre ein Hit daraus geworden. Kaum hatte ich den Gedanken zu Ende gedacht, erschrak ich über mich selbst.
In letzter Zeit habe ich viel darüber nachgedacht, wie viel von meinem Leben die Leute da draußen eigentlich angeht. Ich habe gut 19 000 Instagram-Follower. Müssen 19 000 Menschen wirklich wissen, wie ich meinen Sonntagnachmittag verbringe? Eigentlich nicht. Die Frage, was ich von dem Leben meiner Mitmenschen teile, habe ich lange Zeit allerdings noch viel unsensibler gehandhabt. Ich postete, was ich sah und lustig fand, zum Beispiel meine Mutter beim Singen im Auto. Meine Follower fanden meine Mutter lustig. Meine Mutter fand das nicht lustig. Jedes Mal, wenn ich jetzt ein Foto von ihr mache, kommt die Warnung: „Wehe, du tust das auf Instagram!“
Die Jagd nach „Content“ hat mittlerweile Ausmaße angenommen, die mich selbst schockieren. Neulich hat mich eine Freundin dabei gefilmt, wie ich mich über irgendetwas aufregte, und das Video auf Instagram gestellt. Sie fand meine Aufregung witzig. Ich war entsetzt.
Der längst selbstverständliche, auf den eigenen Körper gerichtete Voyeurismus hat offenbar zu der Annahme geführt, dass Voyeurismus jetzt generell total okay ist. Früher galt es als creepy, andere Leute ohne deren Wissen zu filmen oder zu fotografieren. Heute ist das salonfähig. Jeder Blödsinn ist eine Story, jeder Mensch ein Newsjournalist, Berichterstatter seiner ach-so-komischen Umgebung. Letzte Woche ging der Live-Ticker einer Frau namens Rosey Blair viral, die auf einem Flug von New York nach Dallas Zeugin der romantischen Annäherung zweier Mitreisender wurde – und diese mit Fotos minütlich auf Twitter dokumentierte, ohne dass die beiden etwas davon mitbekamen. Sie teilte sogar einen Schnappschuss davon, wie sie gemeinsam zur Toilette gingen. Rosey Blair hat es nicht böse gemeint. Sie sah guten Content. Und sie wähnte sich als Erzählerin des Beginns einer Liebesgeschichte, als Übermittlerin guter Nachrichten. Können wir nicht alle mehr davon gebrauchen? Allein ihr erster Tweet wurde über 300 000 Mal geteilt und 800 000 Mal gelikt. Als die unwissenden Protagonisten ihrer über 50 Tweets aus dem Flugzeug stiegen, waren sie weltberühmt. Der Mann, offenbar amüsiert, ließ sich daraufhin bereitwillig in der „Today“-Show interviewen. Die Frau schaltete ihren Anwalt ein. (Mittlerweile hat Rosey Blair alle Tweets gelöscht und sich entschuldigt)
Der Respekt vor der Privatsphäre anderer war mal selbstverständlich, nichts, was man überhaupt diskutieren musste. Heute, wo viele Jugendliche von einer Karriere als Youtuber oder Influencer träumen und der Zugang zu öffentlicher Aufmerksamkeit, gar Ruhm und Reichtum, greifbarer und verlockender denn je scheint, vergisst man schnell, dass sich nicht jeder über diese Art von Aufmerksamkeit freut. Die gefürchtete Totalüberwachung kommt nicht vom Staat. Sie kommt von jungen Leuten wie mir, die mit den sozialen Medien und der Daueranwesenheit von Kameras aufgewachsen sind und dabei offenbar nicht nur jede Scham, sondern auch die Fähigkeit verloren haben, einen schönen, lustigen oder unterhaltsamen Moment einfach mal schön, lustig oder unterhaltsam zu finden, anstatt ihn für ein Publikum zu dokumentieren. Pete Davidson, Schauspieler und Freund von Arianna Grande, hat seinen Instagram-Account gerade mit dem Argument gelöscht, sein Leben sei einfach zu toll, um es für andere festzuhalten. Wie recht er hat.
Seit ein paar Wochen habe ich ein neues Hobby: Ich gehe frühmorgens spazieren. Mein Handy bleibt zuhause. Ich habe auf diesen Spaziergängen schon wunderschöne Dinge gesehen. Einen Chauffeur im gestärkten weißen Hemd, der mit rührender Hingabe die Fenster seiner schwarzen Limousine poliert. Einen Vater, der seine kleine Tochter an einer Straßenecke verabschiedet und, während sie schon mit wippendem Schulranzen davon hüpft, noch einmal stehen bleibt und ihr mit wehmütigem Blick hinterher sieht. Rasensprenger, die mit tänzerischer Anmut durch Vorgärten wedeln. Eine nackte, nicht mehr so junge Frau mit blauem Handtuch auf dem Kopf, die am Fenster auf einen Verehrer wartet. Das Schöne an diesen Beobachtungen ist, dass sie nur Sekunden dauern. Danach sind sie verpufft und existieren nur noch als Erinnerung in meinem Kopf – nicht als wackeliges Foto, das niemals etwas von der Intensität des echten Lebens vermitteln könnte.

