 Gestern habe ich gegen meine drei besten Freunde ganz kläglich im Monopoly-Spielen verloren. Da wurde klar: ich bin 2014, anders als vorgesehen, offensichtlich nicht wirklich schlauer geworden. Eigentlich habe ich immer gedacht, Monopoly sei ein Glücksspiel, aber das ist gelogen, tatsächlich muss man dafür richtig intelligent sein, oder zumindest ein smarter Geschäftsmensch. Mit solchen Vorzügen kann ich nach wie vor leider nicht punkten. Freund A. bot mir listig den Gänsemarkt und Ballindamm zum Tausch gegen den Hamburger Flughafen und sackte anschließend horrende Mieten für jeden Besucher auf letzterem ein. Ich dagegen musste mich am Rande des Bankrotts bei der Bank verschulden und eine Hypothek für die Milchstraße aufnehmen. Monopoly ist ein gemeines Spiel, gemein ehrlich, genau wie das echte Leben, das ist schließlich auch kein Ponyhof.
Gestern habe ich gegen meine drei besten Freunde ganz kläglich im Monopoly-Spielen verloren. Da wurde klar: ich bin 2014, anders als vorgesehen, offensichtlich nicht wirklich schlauer geworden. Eigentlich habe ich immer gedacht, Monopoly sei ein Glücksspiel, aber das ist gelogen, tatsächlich muss man dafür richtig intelligent sein, oder zumindest ein smarter Geschäftsmensch. Mit solchen Vorzügen kann ich nach wie vor leider nicht punkten. Freund A. bot mir listig den Gänsemarkt und Ballindamm zum Tausch gegen den Hamburger Flughafen und sackte anschließend horrende Mieten für jeden Besucher auf letzterem ein. Ich dagegen musste mich am Rande des Bankrotts bei der Bank verschulden und eine Hypothek für die Milchstraße aufnehmen. Monopoly ist ein gemeines Spiel, gemein ehrlich, genau wie das echte Leben, das ist schließlich auch kein Ponyhof.
Zu dieser Weisheit gelangte ich übrigens bereits an letztem Neujahr, als ich beschloss, dass „man es mit den gesundheitsfetischistischen Vorsätzen auch gleich bleiben lassen, jeden Morgen Carpe Diem predigen und das Beste aus seiner Existenz machen“ sollte. Passend zu dieser guten Absicht und lauter großen (und groß gespuckten) Plänen für 2014 trug ich ein reichlich verknotetes Outfit von Henrik Vibskov und fühlte mich darin unbeschwert wie ein Zirkusdirektor. Aber Moment. Stopp. Was war das noch mal mit dem Gesundheitsfetischismus?
Pure Ironie! Kollektiv einigten wir uns in der Kommentarspalte darauf, dass das Leben mit Nutella-Brot und Spaghetti Napoli mehr Spaß macht als ohne, und konnten uns somit glücklicherweise wieder mit vereinten Kräften ums Carpe Diem kümmern.
Aber ach, Carpe Diem war 1964 auch einfacher als 2014. Damals konnte man sich als Frau betörend kleiden und gleichzeitig die Pille nehmen und für Feminismus werben. Ist sexy tot? fragte ich mich dagegen im April, nachdem eine Wildfremde mein Outfit als „gefährlich“ eingestuft hatte. „Ist Tollaussehen nicht eigentlich unsere wichtigste Geheimwaffe?“ schrieb ich dazu zugegebenermaßen reichlich frech und provozierte gleich mal 27 Kommentare (Rekord!). Und rätselte weiter: „Wenn wir diese Waffe ablegen, nur um in unseren Schlabberhosen, Badelatschen, Bomberjacken und Sackkleidern besonders lässig und androgyn und cool auszusehen, muss das dann nicht heißen, dass wir uns bloß dem Stil der Männerwelt unterwerfen?“
Die Damenmode ist im Jahr 2014 wahrhaftig nicht damenhafter geworden. Das ging gleich im Januar mit der Haute-Couture-Show von Chanel los, als Karl Lagerfeld Turnschuh und Knieschoner in die Beletage der Modewelt hob. „Turnschuhe zur höchsten Schneiderkunst? Ist das erlaubt? Was sollte die Haute Couture mit dem echten Leben schon zu tun haben wollen?“ zweifelte ich noch, aber tatsächlich bin ich selbst 2014 auch nicht auf viel anderem als bequemen Gummisohlen gelaufen. Weil ich mir den neuen Brillanten der Turnschuhwelt, Dior’s Fusion Sneaker, leider nicht leisten konnte, gönnte ich mir mit gestreiften Badelatschen und Adidas Superstars eine preiswerte Ersatzbefriedigung.
So ist also auch mein Kleiderschrank in diesem Jahr nicht um viel Weibliches reicher geworden. Stattdessen legte ich mir in den vergangenen 12 Monaten mit großem Eifer 27 mitunter ziemlich zweifelhafte Kleidungsstücke zu. Die Top 5 der ulkigsten Outfits auf C’est Clairette: ein Pluderhose zum Durchatmen, ein handbekleckstes Hemd fast wie von Céline – Abendkleids Auferstehung zu fetzigen Jeanshosen – eine sonnengelbe Palazzo-Hose von 1986 – dieses Ensemble aus karierter Wolljacke und Zigarettenhose, bei dessen Anblick mich das New York Magazine verdächtigte, ich habe es gestohlen „from your grandpa in Florida who spends his days power walking and playing golf“. Die Ähnlichkeit zu Cher Horovitz in „Clueless“ lag allerdings auch nicht fern, vor allem, nachdem ich bereits in diesem Artikel farblich harmonische Kleidersets à la Cher als bestes Heilmittel gegen Garderobenkrisen beschrieben hatte. Den schönsten und bissigsten Kommentar bekam ich jedoch zu meiner blau-weiß-geblümten Culotte-Hose zu lesen: „Die Hose eine Kreuzung aus Bettdecke und Kaffeekanne“, schrieb Anonymus, „an Hüfte und Oberschenkeln verschnitten, Stoff knittrig. Oben Sibirien, unten Santorin.“






Abgesehen von ein paar wenigen Schlechte-Laune-Tagen war ich 2014 aber wirklich mehr als positiv aufgelegt. Es gab schließlich auch permanent Anlass zu Freude: ob Freundin L. mich in ihrem orangefarbenen Auto spazieren fuhr, „dem einzig wahren Ort zum Musikhören“, Cristiano Ronaldo splitternackt das Cover der VOGUE zierte, Rihanna im durchsichtigen Strasskleid zur Stilikone wurde und damit bewies, dass „Stilikone sein erstaunlich wenig mit Modebewusstsein zu tun“ hat, oder Anna Wintour Oberarmübungen vorturnte – im Großen und Ganzen habe ich mich in diesem Jahr wirklich ganz königlich amüsiert.
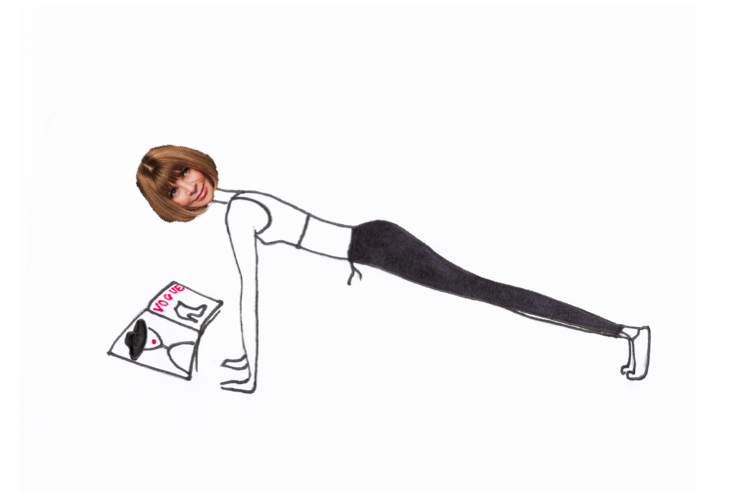
Dass es aber nicht Kleider sind, die mich zu einem cooleren Menschen machen, war spätestens klar, nachdem mich auf einer New Yorker Dachterrasse ein Mensch für uncool erklärte, bloß weil ich Campari Orange trinken wollte. „Wie werde ich cool?“, rätselte ich daraufhin verzweifelt, und schrieb dann diese Anleitung zum Coolwerden nieder: „Cool sind Leute, die auch mal was machen, was im Allgemeinen als uncool gilt. Zum Beispiel Mandoline spielen. Kein Handy besitzen. Im Anzug Schlittschuh fahren. Oder ihr Kind Otto nennen, obwohl gerade Namen wie Luca, Finn oder Anton hip sind.“

Ziemlich cool, so lernte ich in New York, sind übrigens auch amerikanische Supermärkte. „Gebirge makelloser Hochglanzäpfel“, „Bananen in warmem Tropenlicht“ und „fünf Meter lange Salatregale“ kann man da bewundern, außerdem „Burritos, light in sodium“ kaufen, „Dr. Praeger’s Veggie Burger, gluten-free“ oder 14 verschiedene Hummus-Sorten. „Amerikanische Supermärkte sind wie ganz Amerika: die reinste Reizüberflutung, ein Fest des Konsums, alles gibt es im Überfluss, in Übergrößen, in Familienpackungen, in zig verschiedenen Geschmacksrichtungen und Fette-Graden. Wer“, fragte ich mich ernsthaft besorgt, „soll das eigentlich alles essen?“ Wenn ich in New York nicht gerade mit Nahrungsaufnahme oder Einkaufsbummel beschäftigt war, lief ich stundenlang durch die Stadt, bewunderte die Schaufenster auf der Fifth Avenue oder saß auf dem Washington Square herum. Und dann fiel es mir plötzlich wie Schuppen von den Augen:„Der Busen ist zurück!“ verkündete ich mit großer Freude und war in diesem Punkt sogar mit dem New York Magazine einer Meinung, das zeitgleich eine Reihe herrlicher Busenzeichnungen inklusive Busenweisheiten veröffentlichte, zum Beispiel: „Never have more Martinis than you have breasts!“
Wenn ich in New York nicht gerade mit Nahrungsaufnahme oder Einkaufsbummel beschäftigt war, lief ich stundenlang durch die Stadt, bewunderte die Schaufenster auf der Fifth Avenue oder saß auf dem Washington Square herum. Und dann fiel es mir plötzlich wie Schuppen von den Augen:„Der Busen ist zurück!“ verkündete ich mit großer Freude und war in diesem Punkt sogar mit dem New York Magazine einer Meinung, das zeitgleich eine Reihe herrlicher Busenzeichnungen inklusive Busenweisheiten veröffentlichte, zum Beispiel: „Never have more Martinis than you have breasts!“
 Mit dieser schönsten aller Weisheiten geht das Jahr 2014 nun zu Ende. Und wenn ich so zurückschaue, dann denke ich: vielleicht bin ich doch schlauer geworden, als meine Monopoly-Künste offenbaren mögen. Und überhaupt, was ist das eigentlich für ein komisches Spiel – jedes Mal, wenn man über Los geht, schenkt einem die Bank 4000 Euro?! Als ob mir die Sparkasse jedes Jahr zu Silvester frisches Guthaben überweisen würde! Na, schön wär’s.
Mit dieser schönsten aller Weisheiten geht das Jahr 2014 nun zu Ende. Und wenn ich so zurückschaue, dann denke ich: vielleicht bin ich doch schlauer geworden, als meine Monopoly-Künste offenbaren mögen. Und überhaupt, was ist das eigentlich für ein komisches Spiel – jedes Mal, wenn man über Los geht, schenkt einem die Bank 4000 Euro?! Als ob mir die Sparkasse jedes Jahr zu Silvester frisches Guthaben überweisen würde! Na, schön wär’s.








